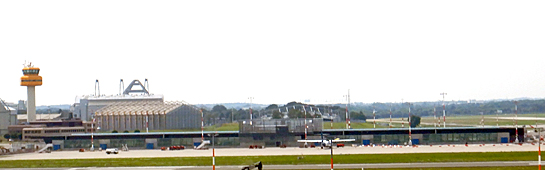|
Am 10. Januar 1911 wurde mit privaten Mitteln in
Höhe von 685.000 Mark die Hamburger Luftschiffhallen GmbH (HLG)
gegründet. Im Januar 1912 wurde der Luftschiffhafen auf rund 45 Hektar
in Betrieb genommen. Zunächst wurde der Flughafen daher vor allem von
Luftschiffen genutzt. Im Jahr 1913 wurde die Fläche auf rund 60 Hektar
ausgedehnt, wobei der nördliche Bereich den Luftschiffen vorbehalten
war, und die Flugzeuge nur den südöstlichen Teil nutzen konnten. Im
Ersten Weltkrieg wurde die Luftschiffhalle ausschließlich vom Militär
genutzt, bis sie am 16. September 1916 durch ein Feuer zerstört wurde,
als die Marineluftschiffe L 6 und L 9 sich beim unsachgemäßen Nachfüllen
von Traggas entzündeten. Obwohl für den militärischen Einsatz
bedeutungslos, baute die HLG die Einrichtungen wieder auf, musste diese
jedoch aufgrund des Versailler Vertrags wieder unbrauchbar machen.
Im Februar 1919 gab es für den Flughafen einen
Neubeginn, mit der Aufnahme einer Verbindung nach Berlin durch die
Deutsche Luft-Reederei (DLR). Ab 1920 benutzte auch KLM den Flughafen
als Zwischenstopp auf einer Linienverbindung, die Rotterdam und
Amsterdam mit Kopenhagen verband. Im selben Jahr wurde auch die erste
Statistik erstellt, wobei man 348 Starts und Landungen mit 241
Passagieren zählte. Im Jahr 1929 entstand das erste Terminal und Anfang
1934 wurde auf Betreiben des Hamburger Innensenators Alfred Richter ein
Denkmal eingeweiht, das den Versailler Vertrag und die damit
einhergehenden Einschränkungen anprangerte. Mitte der 1930er-Jahre war
der Flughafen mit der Strecke Hamburg, Belgrad, Athen, Rhodos, Damaskus
und Bagdad Ausgangspunkt der damals längsten Flugroute der Welt.[5]
Während des Zweiten Weltkriegs wurden ab 1942 Zwangsarbeiter bei der
Tarnung des Flughafens eingesetzt.
%20kl.jpg) Seinen
Namen Hamburg Airport erhielt der Flughafen 1945 durch die britische
Besatzungsmacht. Am 3. Mai 1945 wurde der fast unzerstörte und
funktionsfähige Flughafen im Zuge der Übergabe der Stadt Hamburg an
britische Streitkräfte vom Fliegerhorstkommandanten an einen Offizier
der Royal Air Force (RAF) übergeben. Im Herbst 1945 wurde von der RAF
eine 1600 Yard (rund 1465 Meter) lange, provisorische Start- und
Landebahn (Behelfsbahn) einschließlich Rollstreifen (englisch Taxi
strip) aus durchlochten Stahlblechen (englisch pierced steel planking,
auch PSP-Platten oder Marston mats genannt) angelegt. Ab dem Sommer 1946
wurde der Flughafen wieder für zivile Zwecke genutzt und am 1. September
1946 nahm British European Airways die erste Linienverbindung
(London–Amsterdam–Hamburg–Berlin) auf. Anfang 1947 folgte die
Scandinavian Airline System (SAS) auf der Strecke Kopenhagen–Hamburg,
die wenig später nach Frankfurt am Main verlängert wurde. Außerdem flog
die Sabena die Strecke Brüssel–Hamburg und die KLM Amsterdam–Hamburg. Im
Herbst 1947 übertrug die RAF dem Civil Aviation Branch (CAB), der
Luftfahrtbehörde der Control Commission for Germany/British Element, die
Flughafenaufsicht über den Hamburger Flughafen. Wegen des stark
angestiegenen Flugverkehrs wurde ein weiterer Ausbau des Flughafens
erforderlich. Seinen
Namen Hamburg Airport erhielt der Flughafen 1945 durch die britische
Besatzungsmacht. Am 3. Mai 1945 wurde der fast unzerstörte und
funktionsfähige Flughafen im Zuge der Übergabe der Stadt Hamburg an
britische Streitkräfte vom Fliegerhorstkommandanten an einen Offizier
der Royal Air Force (RAF) übergeben. Im Herbst 1945 wurde von der RAF
eine 1600 Yard (rund 1465 Meter) lange, provisorische Start- und
Landebahn (Behelfsbahn) einschließlich Rollstreifen (englisch Taxi
strip) aus durchlochten Stahlblechen (englisch pierced steel planking,
auch PSP-Platten oder Marston mats genannt) angelegt. Ab dem Sommer 1946
wurde der Flughafen wieder für zivile Zwecke genutzt und am 1. September
1946 nahm British European Airways die erste Linienverbindung
(London–Amsterdam–Hamburg–Berlin) auf. Anfang 1947 folgte die
Scandinavian Airline System (SAS) auf der Strecke Kopenhagen–Hamburg,
die wenig später nach Frankfurt am Main verlängert wurde. Außerdem flog
die Sabena die Strecke Brüssel–Hamburg und die KLM Amsterdam–Hamburg. Im
Herbst 1947 übertrug die RAF dem Civil Aviation Branch (CAB), der
Luftfahrtbehörde der Control Commission for Germany/British Element, die
Flughafenaufsicht über den Hamburger Flughafen. Wegen des stark
angestiegenen Flugverkehrs wurde ein weiterer Ausbau des Flughafens
erforderlich.
Im Winter 1947/1948 beauftragte die RAF das
Tiefbauamt der Hamburger Baubehörde damit, den notwendigen Ausbau
vorzunehmen. Entsprechend der vorherrschenden Windrichtungen sollte eine
2000 Yard (rund 1830 Meter) lange Hauptlandebahn (auch
Schlechtwetterbahn bzw. Startbahn I) in Nordost-Südwest-Richtung und
eine 1600 Yard (rund 1465 Meter) lange Nebenlandebahn (auch
Schönwetterbahn bzw. Startbahn II) in Nordwest-Südost-Richtung
angeordnet und so angelegt werden, dass sich ein hindernisfreier Anflug
ergab. Am 6. April 1948 wurde mit durchschnittlich 800 Arbeitern der
Ausbau begonnen. Die Planung sah vor, die ersten 1600 Yards der
Hauptlandebahn bis zum 31. Dezember 1948 fertigzustellen. Nachdem die
RAF in Absprache mit der Combined Airlift Task Force (CALTF) im Oktober
1948 entschied, Fuhlsbüttel in die Berliner Luftbrücke einzubinden,
wurde die vollständige Fertigstellung auf 2000 Yards Länge bis zum
Dezember 1948 angeordnet. Zur Beschleunigung der Arbeiten wurden
daraufhin bis zu 1400 Arbeiter in zwei, teilweise sogar in drei
Schichten pro Tag eingesetzt. Am 15. Dezember 1948 um 11:50 Uhr landete
die erste Avro Anson Mk. IV auf der fertiggestellten neuen Betonpiste.
Der Hamburger Flughafen war der einzige zivile deutsche Flugplatz, der
in die Luftbrücke einbezogen wurde. Hier wurden alle an der Luftbrücke
teilnehmenden zivilen britischen Chartergesellschaften stationiert. Am
15. August 1949 endete die Teilnahme des Flughafens an der Luftbrücke.
%20kl.jpg) Am
1. Oktober 1950 wurde die Verwaltung des Flughafens zurück in deutsche
Hände übergeben und von der Hamburger Flughafenverwaltung GmbH
übernommen. Zum ersten Direktor ernannte der Hamburger Senat den
ehemaligen Luftwaffen-Oberst Max Wachtel. Als die Lufthansa im April
1955 zuerst den innerdeutschen Flugbetrieb nach München und im Juni den
internationalen Flugbetrieb nach New York wieder aufnahm, war Hamburg
ihr Heimatflughafen, bis Frankfurt diese Rolle übernahm; die Zentrale
von Lufthansa Technik ist heute immer noch in Hamburg beheimatet. Im
Oktober 1959 nahm Pan Am den ersten Linienflug mit einem Düsenflugzeug,
der damals fortschrittlichen Boeing 707, nach Hamburg auf. Das Routing
war New York – London – Hamburg – Kopenhagen. Am
1. Oktober 1950 wurde die Verwaltung des Flughafens zurück in deutsche
Hände übergeben und von der Hamburger Flughafenverwaltung GmbH
übernommen. Zum ersten Direktor ernannte der Hamburger Senat den
ehemaligen Luftwaffen-Oberst Max Wachtel. Als die Lufthansa im April
1955 zuerst den innerdeutschen Flugbetrieb nach München und im Juni den
internationalen Flugbetrieb nach New York wieder aufnahm, war Hamburg
ihr Heimatflughafen, bis Frankfurt diese Rolle übernahm; die Zentrale
von Lufthansa Technik ist heute immer noch in Hamburg beheimatet. Im
Oktober 1959 nahm Pan Am den ersten Linienflug mit einem Düsenflugzeug,
der damals fortschrittlichen Boeing 707, nach Hamburg auf. Das Routing
war New York – London – Hamburg – Kopenhagen.
Im Jahre 1960 bekam Hamburg eine Jet-Verbindung
nach Tokio: Air France stoppte auf ihren neuen Flügen von Paris über die
Polroute via Anchorage nach Tokio in Hamburg, geflogen wurde mit damals
nagelneuen Boeing 707. Kurz darauf nahm auch Lufthansa den Jet-Verkehr
nach Japan auf und flog mit Boeing 707 die Strecke Frankfurt – Hamburg –
Anchorage – Tokio. 1965 startete Japan Air Lines als dritter Mitbewerber
eine Direktverbindung von Tokio nach Hamburg, geflogen wurde mit Douglas
DC-8 via Anchorage und ab Hamburg weiter nach London. Ab Mitte der
1960er-Jahre wurde die Verlegung des Flughafens nach Heidmoor bei
Kaltenkirchen angestrebt. Gründe dafür lagen unter anderem in der
Umweltbelastung durch Fluglärm, der die Bevölkerung in Hamburg,
Norderstedt, Quickborn und Hasloh ausgesetzt war, sowie im
Flugzeugunglück am 17. Dezember 1960 in München.
In den letzten Jahren haben die Bestrebungen,
mit dem Bau des Großflughafens Kaltenkirchen den Hamburger Flughafen zu
ersetzen, durch negative Erfahrungen mit stadtfernen Flughäfen und
Veränderungen in der Verteilung der Großflughäfen im norddeutschen Raum
auch von Seiten der Wirtschaft scharfen Widerspruch erhalten. Die vor
allem auf Dienstleistungen ausgerichtete Wirtschaft in Hamburg ist auf
einen schnell erreichbaren Stadt-Flughafen mit europäischen Verbindungen
angewiesen. 1965 und 1971 erhielt Hamburgs Flughafengesellschaft jeweils
eine Baugenehmigung. Zuletzt waren vier Landebahnen und sechs Terminals
im Bauplan vorgesehen. Ziel war es, 60 Millionen Passagiere jährlich
abzufertigen. Bis heute besitzt der Betreiber Flächen in
Kaltenkirchen.[9] Einer Realisierung der seit den 1960er-Jahren
laufenden Umzugsplanung wurde 2013 eine Absage erteilt. Ab 1970 setzte
Air France die damals neue Boeing 747 auf der Polroute Richtung Tokio
ein und war damit die erste Fluggesellschaft, die diesen Flugzeugtyp im
Liniendienst nach Hamburg brachte. Wenig später stellte auch Japan Air
Lines ihre Flüge auf Boeing 747 um, Lufthansa hingegen erst Mitte der
1970er. Wenige Jahre nach Indienststellung der Boeing 747 entfiel
Hamburg für Air France als Stopp auf der Polroute.
Im Juni 1980 nahm Northwest Orient Hamburg
als ihr erstes deutsches Ziel in ihren Flugplan auf, dreimal wöchentlich
wurde die Strecke Minneapolis – London/Gatwick – Hamburg mit Boeing 747
bedient. Ab Sommer 1981 wurde das Angebot durch zwei wöchentliche Flüge
auf der Strecke New York/JFK – Kopenhagen – Hamburg erweitert. Anfang
1985 stellte Northwest Orient den Flugbetrieb nach Hamburg ein,
stattdessen flog man nach Frankfurt.
Am 29. April 1985 startete Pan Am das erste Mal seit über zehn Jahren
wieder Direktflüge von New York nach Hamburg: täglich und nonstop ging
es mit Boeing 747 von New York/JFK nach Hamburg.[11] Im Frühjahr 1986
gehörte die Route zu den ersten, auf denen Pan Am (durch die damals
neuen ETOPS-Regularien ermöglicht) zweistrahlige Airbus A310-200 auf
Transatlantikflügen einsetzte. Im Sommer 1988 stoppte Japan Air Lines
ihre Flüge nach Hamburg, ein Jahr später stellte dann auch Lufthansa
ihre Flüge von Hamburg nach Tokio ein. Im Mai 1989 startete Delta Air
Lines erstmals Flüge nach Hamburg, die Strecke Atlanta – London/Gatwick
– Hamburg wurde mit Flugzeugen des Typs Lockheed L-1011 Tristar täglich
bedient. Einige Tage später startete American Airlines einen täglichen
Direktflug von New York/JFK über Brüssel nach Hamburg, als Fluggerät
wurden Boeing 767-200ER eingesetzt. American Airlines beendete ihr
Engagement in Hamburg im März 1990 wieder, da auf neu erworbenen
Strecken nach Südamerika Kapazitäten gebraucht wurden.
Anfang der 1990er-Jahre wurde mit dem
Ausbauprogramm HAM21 eine grundlegende Modernisierung des gesamten
Flughafens begonnen. Zunächst wurde das alte Terminal 4 (heute Terminal
2) gebaut. Gleichzeitig wurde eine etwa 500 Meter lange Pier errichtet,
die weitreichende Auswirkungen für die Terminals 2 und 3 mit sich
brachte. Hier konnten keine Flugzeuge mehr direkt andocken. Das damalige
Terminal 2 wurde daraufhin geschlossen. In der Folgezeit diente es als
Überdachung für den Weg von Terminal 1 zu Terminal 3. Letzteres wurde in
der Folgezeit nur noch für Boardingaktivitäten im Vorfeldbereich
benutzt. Im März 1990 nahm Lufthansa einen täglichen Nonstop-Flug von
Hamburg nach New York/Newark auf, dieser wurde mit Airbus A310-300
bedient und zeitweise bis Berlin/Schönefeld verlängert. Im Mai 1991
stellte Delta Air Lines ihren Direktflug von Atlanta nach Hamburg auf
eine Nonstop-Verbindung um, die fortan mit Boeing 767-300ER bedient und
nach Berlin/Tegel verlängert wurde. Im November 1991 übernahm Delta Air
Lines Pan Am’s Transatlantikstrecken ab New York, womit Delta Air Lines
fortan sowohl Atlanta als auch New York ab Hamburg anbot, dies bedeutete
auch den Abschied von Pan Am in Hamburg. Ab April 1992 flog Lufthansa
zusätzlich zweimal wöchentlich mit McDonnell Douglas DC-10 Nonstop nach
Miami, dieser Flug wurde jedoch im Herbst wieder eingestellt, zusammen
mit dem Nonstop-Flug nach Newark. Im Jahre 1993 nahm South African
Airways Hamburg in ihren Flugplan auf, zweimal wöchentlich wurde der
Flug Kapstadt – Johannesburg – München nach Hamburg verlängert, zum
Einsatz kamen Boeing 747.
Ende 1994 wurde der Flug jedoch wieder
eingestellt. Aufgrund von großen finanziellen Schwierigkeiten musste
Delta Air Lines ihr Streckennetz deutlich reduzieren und ihre Flotte
verkleinern, dem fielen auch die Flüge nach Hamburg zum Opfer. Im
Oktober 1995 stellte Delta Air Lines die Strecken Atlanta – Hamburg und
New York – Kopenhagen – Hamburg ein, womit Hamburg die letzten
Direktflüge in die USA verlor. Zur Sommersaison 1996 nahm die kanadische
Charterfluggesellschaft Canada 3000 Flüge nach Hamburg auf, es wurden
Flüge nach Halifax und Toronto angeboten, wobei Boeing 757-200 zum
Einsatz kamen. Mit Einführung des Airbus A330-200 wurde auch die Strecke
Vancouver – Calgary – Hamburg angeboten. Im Mai 1998 nahm Delta Air
Lines wieder Flüge nach Hamburg in ihr Programm auf, es ging mit Boeing
767-300ER täglich von Atlanta Nonstop nach Hamburg. Anfang 2000 wurde
der Flug wieder eingestellt, weil man Schwierigkeiten hatte, die damals
sehr große Business Class ausreichend auszulasten und nun durch die neu
gegründete SkyTeam-Allianz die Passagiere bequem über Paris routen
konnte. Ende 2001 verschwand dazu Canada 3000 aus dem Flugplan aufgrund
des Konkurses der Airline.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends wurde das
Terminal 2 abgerissen und moderner neu gebaut. Am 25. Mai 2005 wurde das
Terminal eingeweiht und erhielt die Bezeichnung Terminal 1. Zur gleichen
Zeit fand die Umbenennung des Terminals 4 in Terminal 2 statt. Das bis
dahin als Abfluggebäude für Charter-Fluggesellschaften genutzte Terminal
1 existiert noch, wird aber seither nur noch für Veranstaltungen
vermietet. Es wird heute als Terminal Tango bezeichnet. Das ehemalige
Terminal 3 wurde für den Bau des neuen Airport Plaza abgerissen. Im Mai
2005 startete Air Transat einen wöchentlichen, saisonalen Nonstop-Flug
von Toronto nach Hamburg, geflogen mit Airbus A310-300. Ab Juni 2005
erhielt Hamburg auch wieder eine Nonstop-Verbindung in die USA:
Continental Airlines nahm einen täglichen Nonstop-Flug von ihrem
Drehkreuz New York/Newark nach Hamburg auf, geflogen mit einer Boeing
757-200. Ab Ende Oktober 2005 wollte Emirates einen Nonstop-Flug von
Dubai nach Hamburg starten, der Termin musste aber aufgrund von
verspäteten Auslieferungen neuer Flugzeuge zweimal verschoben werden.
Letztlich landete am 1. März 2006 erstmals ein Airbus A330-200 von
Emirates in Hamburg, die Strecke wurde fortan täglich bedient. Ende
Oktober 2006 bot Emirates unter Nutzung derer Rechte der fünften
Freiheit mit New York/JFK ein zweites Ziel ab Hamburg an, geflogen wurde
die Route Dubai – Hamburg – New York mit Boeing 777-300ER. Nachdem die
Route ein Jahr später auf Airbus A340-500 umgestellt worden war, stellte
man die Strecke Hamburg – New York im Frühsommer 2008 ein. Ein großes
Ungleichgewicht der Nachfrage auf beiden Teilstücken der Flüge, immer
weiter steigende Ölpreise sowie Verhandlungen über weitere Landerechte
in Deutschland führten zu dieser Entscheidung. Dubai wurde weiterhin
einmal täglich mit Boeing 777 angeflogen.
Im Dezember 2008 ging die Bahnanbindung an den
Flughafen in Betrieb, seither fährt die S-Bahn-Linie S1 alle zehn
Minuten zum Hamburg Airport, damit besteht eine umsteigefreie Verbindung
unter anderem zum Hauptbahnhof, zum Jungfernstieg und nach Altona. Zuvor
war der Flughafen nur mittels Umstieg in den Bus erreichbar. Ende
Oktober 2009 wurde das neue Radisson Blu Hotel Hamburg Airport eröffnet.
Es ist das letzte zum Ausbauprogramm HAM21 gehörende Teilprojekt und
wurde vom Hamburger Büro K2B entworfen. Nach Ende der Sommersaison 2011
gab Air Transat bekannt, Hamburg 2012 nicht mehr anzufliegen, kurz
darauf zog sich die Fluggesellschaft komplett aus Deutschland zurück.
Als Grund wurde die harte Konkurrenz durch Fluggesellschaften wie
Lufthansa und Air Canada angegeben. Im selben Jahr erhöhte Emirates ihr
Angebot in Hamburg: ab September wurde die Strecke zweimal täglich
geflogen. Zum Winterflugplan 2015 stellte United Airlines, welche die
Strecke New York/Newark seit ihrer Fusion mit Continental Airlines
betreibt, auf die größere Boeing 767-300ER um, wobei im Hochsommer auch
Boeing 767-400ER zum Einsatz kamen. Neben einer hohen Nachfrage
besonders in den Sommermonaten gab es mit der Boeing 757 in den
Wintermonaten aufgrund des Jetstreams immer wieder außerplanmäßige
Tankstopps, weil die Strecke am Rande der Reichweite der 757 liegt.
Im Jahre 2016 startete der Flughafen eine
Kompletterneuerung des Vorfeldes (Vorfeld 1). Diese geschieht
etappenweise im laufenden Betrieb und wird bis in das Jahr 2020 dauern.
Dabei werden bzw. wurden Doppelrollgassen eingerichtet (auf dem Taxiway
können entweder zwei kleinere Flugzeuge parallel oder ein großes einzeln
verkehren), Follow-the-greens installiert und zwei Gate-Positionen in
ausreichender Größe für Airbus A380 errichtet. Landeanflug einer
Passagiermaschine von Südwesten auf die Landebahn 05. Die angrenzende
Straße (Vogt-Cordes-Damm) bietet mehrere
Flugzeugbeobachtungsstandorte rund um den Flughafen Hamburg.
Die Air Force One des damaligen US-Präsidenten Trump auf dem Flughafen
Hamburg am 8. Juli 2017. Im Frühjahr 2017 gab United Airlines bekannt,
Hamburg ab sofort nur noch in der Sommersaison anzufliegen. Nach der
Sommersaison 2018 zog man sich komplett aus Hamburg zurück. Ende Oktober
2018 stellte Emirates eine der beiden täglichen Verbindungen aus Dubai
auf Airbus A380 um, was in Hamburg den ersten Einsatz dieses
Flugzeugtyps im Linienverkehr bedeutete und mediale Beachtung fand.
|